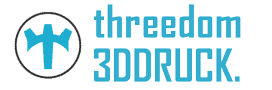Mobile 3D-Druck-Technik repariert Stahlbrücke vor Ort
Das Wichtigste in Kürze
- Forscher haben eine 3D-Druck-Technik zur Reparatur von korrodierten Stahlbrücken erfolgreich im Feld getestet.
- Das sogenannte Kaltspritzverfahren ermöglicht Reparaturen direkt vor Ort, wodurch lange Sperrungen vermieden werden können.
- Bei dieser Methode wird Stahlpulver mit hoher Geschwindigkeit auf die beschädigten Stellen gesprüht, um diese Schicht für Schicht wieder aufzubauen.
- Ein Team der University of Massachusetts Amherst und des MIT führte den ersten Praxistest an einer Brücke in Massachusetts durch.
- Die Technologie verspricht, die Lebensdauer von Brücken kostengünstig zu verlängern und die Instandhaltung von Infrastruktur zu vereinfachen.
Ein weitverbreitetes Problem: Der Zustand von Stahlbrücken
Viele Brücken weltweit weisen erhebliche Schäden durch Korrosion auf. Allein in den USA sind mehr als die Hälfte aller Brücken in einem sanierungsbedürftigen Zustand, was enorme Kosten für die Instandsetzung verursacht. Herkömmliche Reparaturmethoden sind oft teuer und zeitaufwendig, da sie meist mit langen Verkehrssperrungen verbunden sind. Deshalb suchen Ingenieure nach neuen, effizienteren Lösungen für dieses Problem.
Das Kaltspritzverfahren als innovative Reparaturlösung
Eine vielversprechende Methode ist die additive Fertigung, besser bekannt als 3D-Druck. Ein Forscherteam hat nun gezeigt, dass sich das Kaltspritzverfahren (Englisch: Cold Spray) für die Reparatur von Brücken eignet. Diese Technologie ist bereits bei der Instandhaltung von U-Booten oder Flugzeugen im Einsatz, wurde aber bisher nicht für unbewegliche Infrastruktur wie Brücken genutzt.
Wie die Reparatur per 3D-Druck funktioniert
Beim Kaltspritzverfahren wird feines Stahlpulver in einem erhitzten, komprimierten Gasstrom beschleunigt. Ein Techniker trägt dieses Gemisch mit einem speziellen Applikator gezielt auf die korrodierten Stellen des Brückenträgers auf. Die Partikel verbinden sich beim Aufprall mit der Oberfläche und untereinander, sodass Schicht für Schicht neues Material entsteht. Dadurch wird die ursprüngliche Dicke des Trägers wiederhergestellt und seine strukturellen Eigenschaften werden verbessert.
Die Vorteile der mobilen Anwendung
Ein wesentlicher Vorteil dieser Technik ist ihre Mobilität. Anstatt ein Bauteil zum 3D-Drucker zu bringen, kommt der Drucker zur Brücke. Die Reparatur kann direkt vor Ort stattfinden, während der Verkehr mit nur geringen Einschränkungen weiterfließen kann. Dies reduziert nicht nur die Kosten, sondern auch die Belastung für das Verkehrsnetz erheblich.
Erster Praxistest an einer Brücke in Massachusetts
In einer Fallstudie in Great Barrington, Massachusetts, wurde die Methode erstmals erfolgreich an einer echten Brücke getestet. Das Projekt war eine Zusammenarbeit zwischen der University of Massachusetts (UMass) Amherst, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Verkehrsbehörde MassDOT. Vor der eigentlichen Reparatur wurde die beschädigte Stelle digital gescannt. Mithilfe dieser Daten konnte der Materialauftrag präzise geplant werden, was als „digitaler Faden“ bezeichnet wird.
Zukünftige Analysen und Entwicklung
Die reparierte Brücke soll in einigen Jahren planmäßig abgerissen werden. Im Anschluss werden die Forscher die behandelten Träger in ihre Labore bringen. Dort untersuchen sie, wie gut das aufgespritzte Material haftet und wie es sich im Vergleich zu im Labor durchgeführten Tests verhält. Zudem wird geprüft, ob die Korrosion nach der Behandlung fortschritt und welche mechanischen Eigenschaften das neue Material aufweist. Obwohl noch weitere Forschung notwendig ist, stellt dieser erfolgreiche Test einen wichtigen Meilenstein dar.
Unsere Einschätzung
Das Kaltspritzverfahren zeigt eindrucksvoll, wie Technologien aus der additiven Fertigung zur Lösung realer Infrastrukturprobleme beitragen können. Die Möglichkeit, große Metallstrukturen direkt vor Ort und mit minimalen Störungen zu reparieren, ist ein bedeutender Fortschritt. Die Kombination aus digitaler Erfassung und physischem Materialauftrag birgt ein großes Potenzial für die Instandhaltung von Brücken, aber auch von anderen großen Bauwerken. Wenn sich die Methode in weiteren Tests bewährt, könnte sie die Art und Weise, wie wir unsere Infrastruktur warten und erhalten, nachhaltig verändern und dabei helfen, Kosten zu senken und die Lebensdauer von Bauwerken zu verlängern.
Quellen
Den Originalartikel des MIT findest du hier.