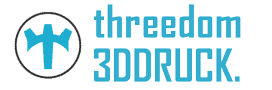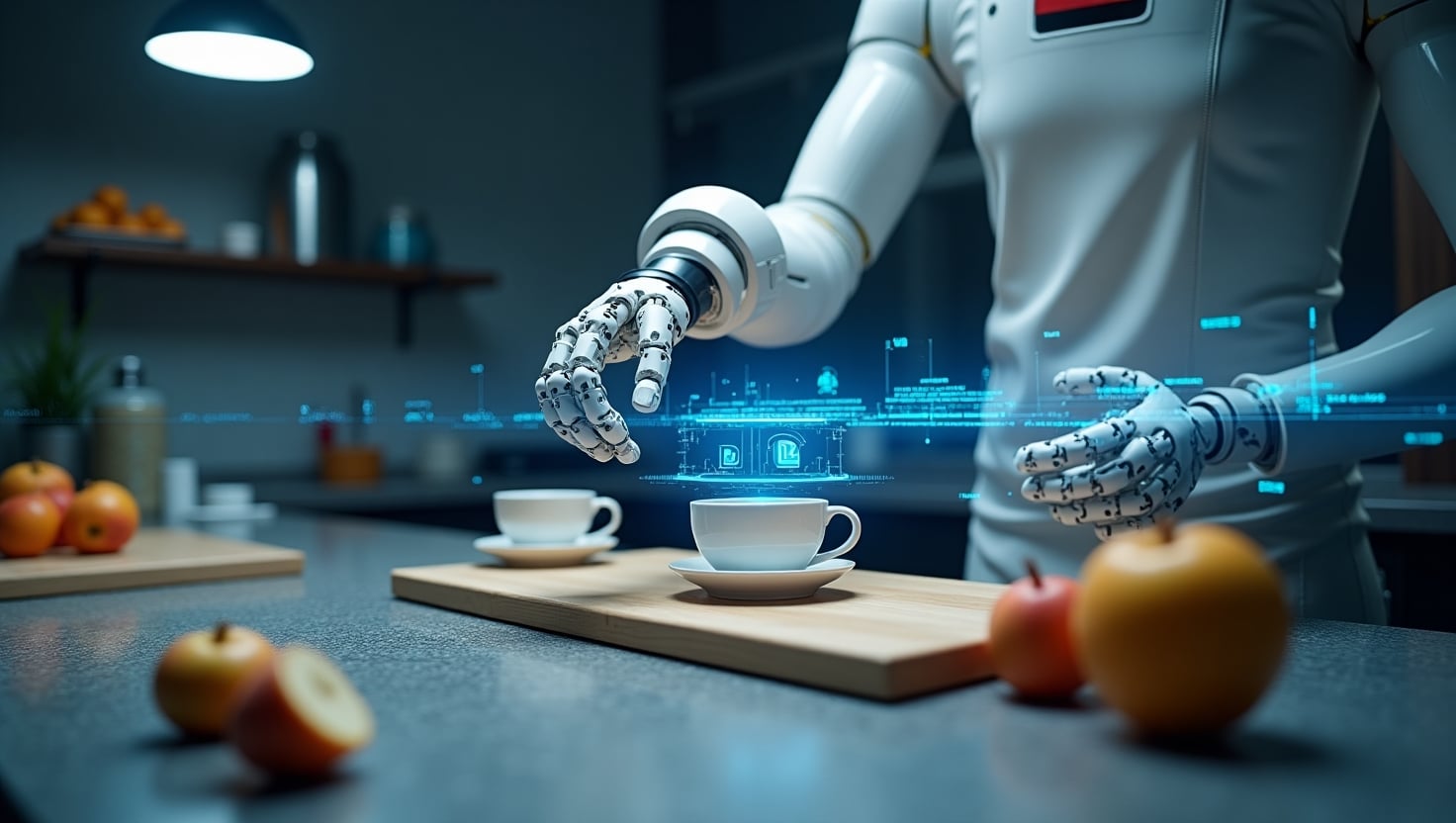MIT startet Kurs zu Biomechanik mit 3D-Bioprinting-Labor
Das Wichtigste in Kürze
- Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) bietet einen Kurs an, der Maschinenbau und Biologie verbindet, genannt „Molekulare, Zelluläre und Gewebe-Biomechanik“.
- Der Kurs konzentriert sich auf Biomechanik, also die mechanischen Eigenschaften biologischer Materialien, und Mechanobiologie, die untersucht, wie Zellen Kräfte wahrnehmen und darauf reagieren.
- Ein überarbeitetes Kurrikulum integriert praktische Laborarbeit in speziellen Werkstätten, den sogenannten Makerspaces, einschließlich 3D-Bioprinting.
- Studierende können so direkt beobachten, wie lebende Zellen auf ihre Umgebung und mechanische Einflüsse reagieren.
- Der Kurs ermöglicht es Studierenden, theoretisches Wissen praktisch anzuwenden und fördert das Verständnis für komplexe biologische Prozesse, was auch für die Forschung, beispielsweise bei Krankheiten wie der Sichelzellenanämie, relevant ist.
Mechanik trifft Biologie: Ein Kurs am MIT
Am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) gibt es einen besonderen Kurs mit der Bezeichnung 2.797/2.798, der sich „Molekulare, Zelluläre und Gewebe-Biomechanik“ nennt. Dieser Kurs schlägt eine Brücke zwischen den Disziplinen Maschinenbau und Biologie. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Fachgebiete: die Biomechanik und die Mechanobiologie. Obwohl die Begriffe ähnlich klingen, beschreiben sie unterschiedliche Aspekte, wie Professorin Ritu Raman vom MIT Department of Mechanical Engineering erklärt.
Biomechanik und Mechanobiologie: Zwei Seiten einer Medaille
Die Biomechanik befasst sich mit den mechanischen Eigenschaften von biologischem Material. Man untersucht zum Beispiel, wie fest ein Knochen ist oder wie elastisch eine Sehne sein kann. Demgegenüber lehrt die Mechanobiologie, wie Zellen Kräfte in ihrer Umgebung spüren und darauf reagieren. Zellen sind also nicht nur passive Bausteine, sondern aktive Einheiten, die mechanische Reize wahrnehmen und verarbeiten können. Professor Raman betont, dass Studierende in diesem Kurs eine einzigartige Verbindung aus mechanischen Grundlagen und aktueller Forschung in beiden Bereichen erhalten. Professor Peter So, der den Kurs gemeinsam mit Professor Raman leitet, ergänzt, dass der Kurs konkrete Anwendungen für grundlegende Theorien aufzeigt und die Wichtigkeit fundamentaler Konzepte verdeutlicht.
Praktisches Lernen im Labor: Biologie zum Anfassen
Um das Lernerlebnis zu intensivieren, wurde das Kurrikulum kürzlich überarbeitet. Ein wesentlicher Bestandteil sind nun praktische Lerneinheiten in Laboren. Diese finden im sogenannten BioMakers Space auf dem Campus und im SHED (Safety, Health, Environmental Discovery Lab) Bioprinting Makerspace statt. Dieser Ansatz lädt Studierende dazu ein, „mit Biologie zu bauen“ und in Echtzeit zu beobachten, wie Zellen auf Kräfte reagieren. Diese Neuerung stieß auf großes Interesse, was sich in der bisher höchsten Teilnehmerzahl für den Kurs zeigte.
Viele Konzepte der Biomechanik und Mechanobiologie sind schwer vorstellbar, da sie auf Größenskalen stattfinden, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Früher wurden diese Ideen durch Bilder, Videos und Gleichungen vermittelt. Die Laborkomponente fügt nun eine weitere Dimension hinzu. Die Hoffnung ist, dass das direkte Beobachten der zellulären Reaktionen dazu beiträgt, dass die Konzepte tiefer verstanden und länger im Gedächtnis behalten werden.
Makerspaces und 3D-Bioprinting als Lernwerkzeuge
Sogenannte Makerspaces sind Werkstätten, die über den gesamten MIT-Campus verteilt sind. Sie bieten Werkzeuge und Arbeitsbereiche für Mitglieder der MIT-Gemeinschaft, um Ideen zu entwickeln, Prototypen zu erstellen und Projekte umzusetzen. Am MIT gibt es über 40 solcher Räume, die Einrichtungen für verschiedene Techniken wie 3D-Druck, Glasblasen, Holz- und Metallbearbeitung umfassen. Der BioMakers Space richtet sich speziell an Studierende, die an praktischen Bioengineering-Projekten arbeiten. Das SHED nutzt ebenfalls moderne Technologien, einschließlich eines neuen Bereichs, der sich auf das 3D-Bioprinting konzentriert. Beim 3D-Bioprinting werden biotaugliche Materialien, oft unter Einschluss von Zellen, schichtweise aufgetragen, um biologische Strukturen zu erzeugen.
Die Begeisterung für die Laborarbeit war so groß, dass das Angebot erweitert wurde. Neben einem Hauptlabor zur Biomechanik der Muskelkontraktion gibt es nun ein zweites Labor, in dem Studierende den SHED Makerspace besuchen, um mehr über 3D-Bioprinting zu erfahren. Zusätzlich wurde eine optionale praktische Komponente in das Abschlussprojekt integriert, die von den meisten Studierenden genutzt wird, um eigene Experimente an der Schnittstelle von Biologie und Mechanik durchzuführen.
Von der Theorie zur Anwendung: Studentische Perspektiven
Kamakshi Subramanian, eine Studentin des Wellesley College, die den Kurs am MIT belegte, berichtete, dass sie in einem früheren Thermodynamikkurs auf ein Polymermodell gestoßen sei, dessen praktische Anwendung ihr jedoch unklar war. Der MIT-Kurs bot ihr einen neuen Bezugsrahmen und zeigte ihr, wie das Denken über Entropie – ein Maß für Unordnung in Systemen – in diesem Kontext nützlich sein kann.
Ayi Agboglo, ein Doktorand der Harvard-MIT Health Sciences and Technology, untersucht die physikalischen Eigenschaften roter Blutkörperchen (RBCs) im Zusammenhang mit der Sichelzellenanämie (SCD). Bei SCD führt Sauerstoffmangel zur Bildung starrer Proteinfasern in den Zellen, was deren mechanische und physikalische Eigenschaften verändert. Der Kurs machte ihn auf Studien aufmerksam, in denen mathematische Modelle verwendet wurden, um mechanische Eigenschaften von RBC-Membranen im Kontext von SCD zu extrahieren. Diese Erkenntnisse haben seine Forschung maßgeblich beeinflusst, die darauf abzielt, patientenspezifische Unterschiede in der Faserbildung zu messen und möglicherweise neue Therapieansätze zu entdecken. Agboglo betonte, dass er nicht nur mehr über molekulare Mechanik gelernt habe, sondern auch grundlegende Konzepte der Thermodynamik und Energie, die für Wissenschaftler generell nützlich sind.
Zukunftspläne und Wissenstransfer
Die Kursleiter Professor Raman, Professor So und Professor Mark Bathe vom Biological Engineering planen, den Anteil an praktischer Laborarbeit in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Neben der Labor- und Vorlesungszeit hatten die Studierenden des Kurses 2.797/2.798 auch die Möglichkeit, mit dem Museum of Science in Boston zusammenzuarbeiten. Gemeinsam erstellten sie frei zugängliche Bildungsressourcen über das Zusammenspiel von Mechanik und Biologie. Diese Materialien sind nun auf der Webseite des Museums verfügbar und tragen dazu bei, das Wissen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Unsere Einschätzung
Der Kurs 2.797/2.798 am MIT stellt einen bemerkenswerten Ansatz dar, um die komplexen Zusammenhänge zwischen Mechanik und Biologie zu vermitteln. Die Integration von praktischer Laborarbeit, insbesondere unter Nutzung moderner Technologien wie dem 3D-Bioprinting in spezialisierten Makerspaces, ist ein entscheidender Faktor für den Lernerfolg. Es ermöglicht den Studierenden, abstrakte Konzepte greifbar zu machen und ein tieferes Verständnis für zelluläre Prozesse und deren Reaktion auf mechanische Einflüsse zu entwickeln. Dieser interdisziplinäre Ansatz bereitet die Studierenden nicht nur auf die Forschung in Bereichen wie der Gewebetechnik oder der Krankheitsbekämpfung vor, sondern fördert auch das kritische Denken und die Fähigkeit, Wissen aus verschiedenen Bereichen zu verknüpfen. Die Kooperation mit dem Museum of Science zur Erstellung öffentlich zugänglicher Lernmaterialien unterstreicht zudem das Engagement, wissenschaftliche Erkenntnisse über die akademische Welt hinaus zu verbreiten. Insgesamt bietet der Kurs eine solide Grundlage und inspiriert zukünftige Ingenieure und Wissenschaftler, an der Schnittstelle von Biologie und Mechanik zu forschen und zu entwickeln.
Quellen
- MIT News: hier