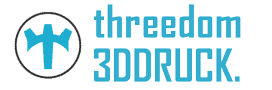Revolutionärer 3D-Druck mit Hydrogel-Vorlage
Das Wichtigste in Kürze
- Forscher der EPFL haben ein neues Verfahren entwickelt, um Metall- und Keramikteile aus 3D-gedruckten Hydrogelen „wachsen“ zu lassen.
- Das Verfahren erzeugt Bauteile, die im Vergleich zu bisherigen Methoden eine bis zu 20-mal höhere Festigkeit aufweisen.
- Die Schrumpfung der Objekte wird auf nur 20 Prozent reduziert, wodurch die Formgenauigkeit deutlich verbessert wird.
- Ein einziger Hydrogel-Druck kann als Vorlage für verschiedene Metalle oder Keramiken dienen, weil das Material erst nach dem Druckprozess hinzugefügt wird.
- Mögliche Anwendungsgebiete sind komplexe Bauteile für die Medizintechnik, Energietechnik und Sensorik.
Neuer Ansatz in der additiven Fertigung: Metall aus Hydrogel
Wissenschaftler der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) haben eine Methode vorgestellt, die den 3D-Druck von Metallen und Keramiken grundlegend verändern könnte. Anstatt direkt mit Metall zu drucken, wird ein einfaches Hydrogel als Vorlage verwendet, in das anschließend das gewünschte Material eingebracht wird. Dieser Ansatz löst zentrale Probleme bestehender Verfahren, die auf der Umwandlung von Polymeren basieren.
Bisherige Techniken, bei denen Polymere nach dem Druck in Metalle oder Keramiken umgewandelt werden, führen oft zu porösen Strukturen. Diese Porosität verringert die mechanische Stabilität der Bauteile erheblich. Zudem kommt es häufig zu einer starken Schrumpfung des Materials, was zu Verformungen und Ungenauigkeiten führt.
Der Prozess Schritt für Schritt erklärt
Das neue Verfahren umgeht diese Nachteile durch einen mehrstufigen Ansatz, der auf einem einfachen, wasserbasierten Gel aufbaut. Der Ablauf ist dabei klar strukturiert.
- Druck der Vorlage: Zuerst wird mittels Bottich-Photopolymerisation, einem etablierten 3D-Druckverfahren, eine präzise Gitterstruktur aus einem Hydrogel gedruckt.
- Infiltration mit Metallsalzen: Die fertige Gel-Struktur wird anschließend in eine Lösung aus Metallsalzen getaucht.
- Umwandlung zu Nanopartikeln: Durch eine chemische Reaktion werden die Salze in winzige, metallhaltige Nanopartikel umgewandelt, die sich gleichmäßig im gesamten Gel verteilen.
- Wiederholung des Zyklus: Dieser Prozess des Eintauchens und Umwandelns wird 5- bis 10-mal wiederholt, sodass der Metallgehalt im Komposit schrittweise ansteigt.
- Entfernung des Gels: Zum Schluss wird das Hydrogel durch Erhitzen vollständig entfernt. Übrig bleibt ein dichtes Objekt aus Metall oder Keramik, das exakt die Form der ursprünglichen Vorlage besitzt.
Vorteile gegenüber etablierten Verfahren
Die Forschungsergebnisse zeigen deutliche Verbesserungen im Vergleich zu früheren Methoden. Die Materialien zeichnen sich durch eine hohe Dichte und Stabilität aus, weil die wiederholte Infiltration die Bildung von Hohlräumen verhindert. Dadurch können die so hergestellten Objekte einem bis zu 20-mal höheren Druck standhalten.
Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die stark reduzierte Schrumpfung. Während bei anderen Verfahren Schrumpfungsraten von 60 bis 90 Prozent üblich sind, beträgt sie bei diesem Ansatz nur etwa 20 Prozent. Dies ermöglicht die Fertigung von Bauteilen mit hoher Maßhaltigkeit. Zudem bietet die Methode eine hohe Flexibilität, denn die Materialwahl findet erst nach dem Druck statt. Dieselbe Hydrogel-Vorlage kann für die Herstellung von Objekten aus Eisen, Silber, Kupfer oder verschiedenen Keramiken verwendet werden.
Anwendungsbereiche und Ausblick
Das Verfahren eignet sich besonders für die Herstellung von Bauteilen, die gleichzeitig komplex, leicht und mechanisch belastbar sein müssen. Mögliche Einsatzgebiete finden sich in der Sensorik, in biomedizinischen Geräten oder in der Energietechnik. Beispielsweise könnten damit metallische Katalysatoren mit einer großen Oberfläche für die Umwandlung von chemischer in elektrische Energie gefertigt werden.
Aktuell arbeitet das Forschungsteam daran, den Prozess weiter zu optimieren. Ein Ziel ist es, die Dichte der Materialien weiter zu erhöhen, um den Anforderungen der Industrie gerecht zu werden. Eine weitere Herausforderung ist die Prozessdauer, da die wiederholten Infiltrationsschritte zeitaufwendig sind. Um die Fertigungszeit zu verkürzen, wird bereits an einer Automatisierung der Prozessschritte mithilfe eines Roboters gearbeitet.
Unsere Einschätzung
Die vorgestellte Methode stellt eine bemerkenswerte Entwicklung in der additiven Fertigung von Metallen und Keramiken dar. Sie umgeht auf intelligente Weise die Kernprobleme bisheriger Umwandlungsverfahren, wie hohe Porosität und unkontrollierte Schrumpfung. Besonders das Prinzip der Materialauswahl nach dem Druckprozess eröffnet neue Möglichkeiten für Flexibilität und Materialvielfalt.
Obwohl die Prozessgeschwindigkeit derzeit noch eine Hürde für die Serienproduktion darstellt, ist das Potenzial für die Herstellung hochleistungsfähiger und komplexer Bauteile beträchtlich. Gelingt die geplante Automatisierung zur Verkürzung der Fertigungszeit, könnte diese Technologie Einzug in spezialisierte industrielle Anwendungen halten, bei denen Präzision und Materialeigenschaften im Vordergrund stehen.
Quellen
- Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, nachzulesen hier.